

Es gibt Gestalter, die poltern. Und es gibt solche, die leuchten. Wilhelm Wagenfeld gehört zur zweiten Sorte. Seine Entwürfe sind keine Statements – sie sind stille Präsenz. Klare Linien, klares Denken. Kein Übermaß, kein Effekt. Stattdessen: Haltung, Handwerk, Licht.

Geboren 1900 in Bremen, aufgewachsen in einer Stadt mit hanseatischer Zurückhaltung und protestantischer Arbeitsethik, geht Wilhelm Wagenfeld seinen Weg mit Präzision, Ernst und einem ausgeprägten Gespür für das Machbare. In einer Welt im Umbruch – zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik, zwischen Tradition und Moderne – entscheidet er sich früh für das Handwerk. Nicht als Rückzug, sondern als Ausgangspunkt.
Nach der Volksschule beginnt er eine Lehre als Silberschmied bei Koch & Bergfeld, einer Bremer Silberwarenmanufaktur mit hohem gestalterischem Anspruch. Schon dort zeigt sich, dass er mehr ist als ein sauber arbeitender Lehrling: Er ist ein Beobachter, ein Fragender. Wie entsteht Form? Was macht ein Objekt sinnvoll? Warum sieht manches selbstverständlich aus – und anderes überflüssig?
Es zieht ihn weiter zur Kunstgewerbeschule Bremen, wo er erstmals mit künstlerischer Gestaltung und materialbewusster Entwurfsarbeit in Berührung kommt. Die Schule wird zu einem Übergangsraum zwischen Praxis und Theorie, zwischen Hand und Kopf. Aber es bleibt bei Andeutungen – Wagenfeld will mehr. Er bewirbt sich an der renommierten Zeichenakademie in Hanau, spezialisiert auf Metallgestaltung. Und hier geschieht etwas Entscheidendes.
In Hanau trifft er auf Christian Dell, den jungen Werkmeister der Metallklasse – selbst ein Absolvent des Weimarer Bauhauses, ein radikaler Denker und präziser Praktiker. Dell ist kein Schwärmer, kein Formalist. Er denkt vom Material her, vom Nutzen, vom Prozess. Und er erkennt schnell, dass in Wagenfeld nicht nur ein fleißiger Handwerker steckt, sondern ein potenzieller Gestalter mit Haltung. Einer, der Fragen stellt. Einer, der mit der Feile denken kann.
Dell fördert ihn. Fordert ihn. Und macht ihn mit der Idee vertraut, dass das Handwerk nicht das Gegenteil von Kunst ist, sondern ihre Grundlage. Dass Gestaltung eine soziale Aufgabe hat. Und dass es Orte gibt, an denen diese Idee gelebt wird – etwa das Staatliche Bauhaus in Weimar.
Am 14. Oktober 1923 bewirbt sich Wilhelm Wagenfeld am Bauhaus in Weimar. Sein dreiseitiger Bewerbungsbrief ist ein Dokument mit Haltung: reflektiert, strukturiert, bescheiden im Ton – und präzise im Ausdruck. Schon am nächsten Tag, am 15. Oktober, bestätigen Walter Gropius, Paul Klee und Josef Hartwig seine Aufnahme. Auf dem offiziellen Bogen vermerkt: „Wurde von Meister Dell als brauchbarer Handwerker bezeichnet.“ Es war wohl mehr als das. Dell, der seit 1922 Werkmeister in der Metallwerkstatt des Bauhauses ist, hat Wagenfeld den Weg geebnet. Und dieser Weg beginnt sofort – ohne Umweg über den Vorkurs. Anders als die meisten Studierenden, die erst Materialstudien und Grundlagenübungen absolvieren, wird Wagenfeld direkt in die Werkstatt aufgenommen. Ein Vertrauensvorschuss, den er nutzt.

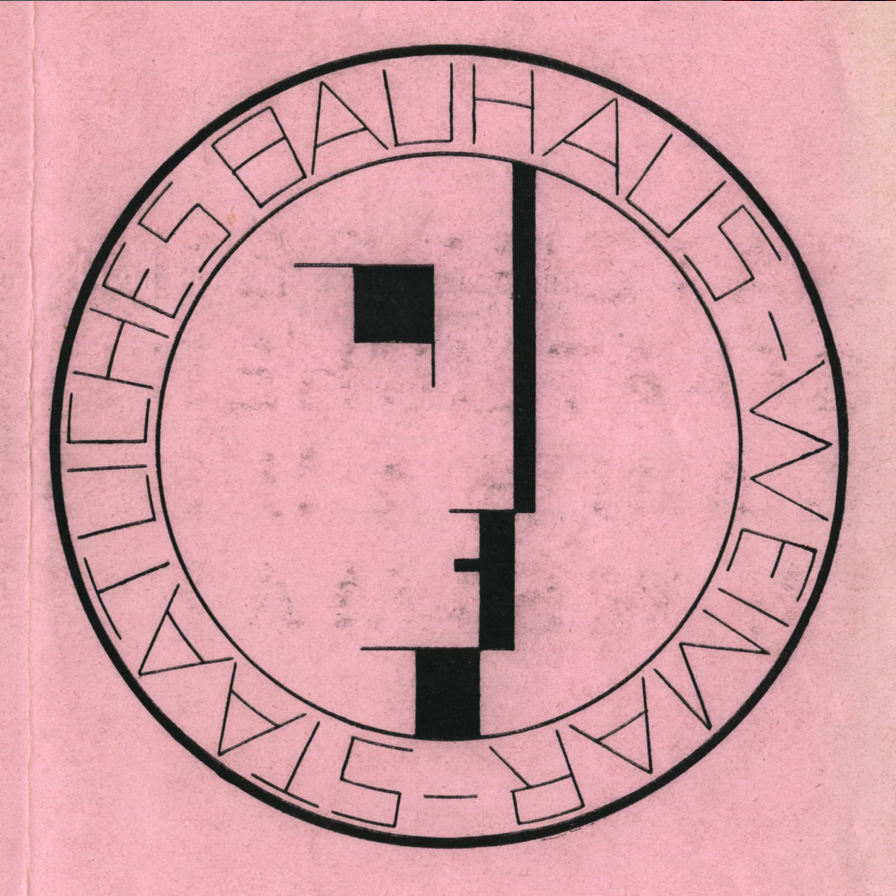

Im Frühjahr 1924 nimmt die Arbeit Fahrt auf. Während das Bauhaus über seine Ausrichtung debattiert – Handwerk oder Industrie? Kunst oder Technik? – arbeitet Wagenfeld an einer Antwort in Form. Walter Gropius ruft bereits 1922 die Parole „Kunst und Technik – eine neue Einheit“ aus. Das neue Bauhaus-Logo von Oskar Schlemmer bringt es auf den Punkt: Ein stilisierter Kopf, konstruierte Klarheit. Auch die Typografie wird zum Zeichen eines neuen Denkens. Wagenfeld nimmt das ernst. Seine Entwürfe werden reduziert, funktional, geometrisch.

Im April 1924 notiert Christian Dell im Monatsbericht nüchtern: „1 Sauciere von Wagenfeld fertig (Gesellenstück) u. 15 Tischleuchten mit eisernem Fuß.“ Dell konnte nicht wissen, dass diese Tischleuchte einmal Designgeschichte schreiben würde. Wagenfeld war damals gerade ein halbes Jahr am Bauhaus – und doch schon bereit für eine Ikone.
Am 16. Juli 1924 listet der Monatsbericht: „10 elektrische Tischlampen Metall und 4 elektr. Tischlampen Glas“. Sie wurden für die Ausstellung „Die Form“ in Stuttgart produziert – dort wurde die Glasversion der später weltberühmten Leuchte erstmals gezeigt. Noch ahnte niemand, dass diese Leuchte – die spätere WG 24 – einmal in zahllosen Wohnungen, Museen und Büros leuchten würde.
Opalglas. Klarglas. Nickel. Mehr braucht es nicht. Die WG 24 ist nicht retro, nicht futuristisch – sie ist zeitlos. Sie ist nicht gemacht, um zu gefallen, sondern um zu bestehen. Ein Lichtobjekt, das durch Reduktion zur Präsenz findet.
Aber Wagenfeld war nicht nur Leuchtendesigner. Er war ein Denker der Dinge, ein stiller Revolutionär des Alltags. Nach seiner Bauhaus-Zeit lehrte er an der Bauhochschule Weimar, später wurde er künstlerischer Leiter der Vereinigten Lausitzer Glaswerke. Und dort zeigte sich seine wahre Vision: Gestaltung für alle. Vorratsgläser, Salzstreuer, Teekannen – Objekte des Gebrauchs, geadelt durch Form und Funktion. Keine Dekoration. Keine Geste. Nur ein Angebot: Nutze mich.



Wagenfelds Entwürfe folgen keinem Stil, sondern einer Haltung: Funktion ist Form.
Das zeigt sich in seinem Glasgeschirr für Schott, seinem stapelbaren Teeservice, seinem berühmten Eierkoch (1933). Alles durchdacht, alles reduziert. Besonders sein Teewärmer von 1930 wirkt fast skulptural: Glas auf Glas, Licht in Leichtigkeit.
Ein weiteres Beispiel für seinen alltagsnahen Gestaltungsansatz ist die Mehrzweckleuchte WNL 30. Ursprünglich in einem Prospekt der "Weimar Bau- und Wohnungskunst GmbH" als „Nachttischlampe, auch als Wandleuchte verwendbar“ betitelt, zeigt sie, wie vielseitig Wagenfeld dachte. Tatsächlich ist sie auch als Klavier-, Regal-, Lese- oder Spiegelleuchte nutzbar. Ein Leuchtobjekt für wechselnde Lebenssituationen – wandelbar, funktional, unaufgeregt. Für die Re-Edition dieser Leuchte durch TECNOLUMEN standen Originalzeichnungen von 1930 zur Verfügung. Gestaltung wird hier zum Dialog mit dem Alltag.
Auch seine Leuchten nach dem Bauhaus zeigen diesen Geist: die WG 28, sachlicher als die WG 24. Die Serie WA 24, Decken- und Wandleuchten, der technische Entwurf WA 23 SW – allesamt Beispiele einer konsequenten, materialbewussten Haltung.
Wenig bekannt, aber exemplarisch: Wagenfelds Tür- und Fensterbeschläge der 1950er-Jahre. Kein Ornament, keine Attitüde. Nur Funktion, formal klar gefasst. Heute wieder hochaktuell.



Nach dem Krieg gründet Wagenfeld 1954 ein eigenes Atelier in Stuttgart. Er arbeitet für Rosenthal, WMF, Braun, Jenaer Glas. Er entwirft Radios, Bestecke, Wohnaccessoires. Immer in derselben Haltung: Nichts Symbolisches. Alles Gebrauch. Und dennoch: poetisch.
Seine Entwürfe erhalten Auszeichnungen: den Grand Prix der Mailänder Triennale, den Bundespreis „Gute Form“. Museen wie das MoMA in New York oder das Vitra Design Museum nehmen seine Arbeiten in die Sammlung auf. Doch Wagenfeld bleibt ruhig. Vielleicht, weil er wusste: Die Dinge sprechen für sich.
Als TECNOLUMEN 1980 gegründet wird, ist klar: Die erste Leuchte soll die WG 24 von Wilhelm Wagenfeld sein. Sie verkörpert alles, was auch TECNOLUMEN ausmacht: Reduktion, Respekt, Handwerk. Wagenfeld war eng in die Re-Edition eingebunden. Jedes Stück trägt das TECNOLUMEN Signet.
Heute werden die berühmten "Bauhausleuchten" – und mit ihnen ein Stück Gestaltungsgeschichte – in der Bremer Manufaktur gefertigt. In Einzelarbeit, nummeriert, präzise.
Wagenfelds Entwürfe sind nicht laut. Aber sie bleiben. Im Alltag, im Regal, in der Hand. In der Geste des Anfassens. In der Haltung des Gebrauchs. Sie sind da – und das genügt. Denn wirklich gutes Design ist sichtbar und vor allem spürbar.
Und vielleicht ist das der leise Triumph des Wilhelm Wagenfeld: Dass seine Dinge nicht nach Aufmerksamkeit suchen. Sondern nach Anwendung.
So wird Licht zu Haltung. Und ein Name zur Idee.

Ein Gruppenfoto aus dieser Zeit zeigt Wagenfeld mit Pfeife, die Stirn leicht gerunzelt, den Blick zur Seite gewandt. Man meint, ihm beim Denken zuzusehen. Vielleicht hat ihn das Foto aus einem Gestaltungsprozess gerissen – vielleicht war er gerade gedanklich an einer Fassung, einem Sockel, einem Glaskörper. Schon im Dezember 1923 berichtet Christian Dell, sein Schüler arbeite „an Entwürfen für Beleuchtung“.